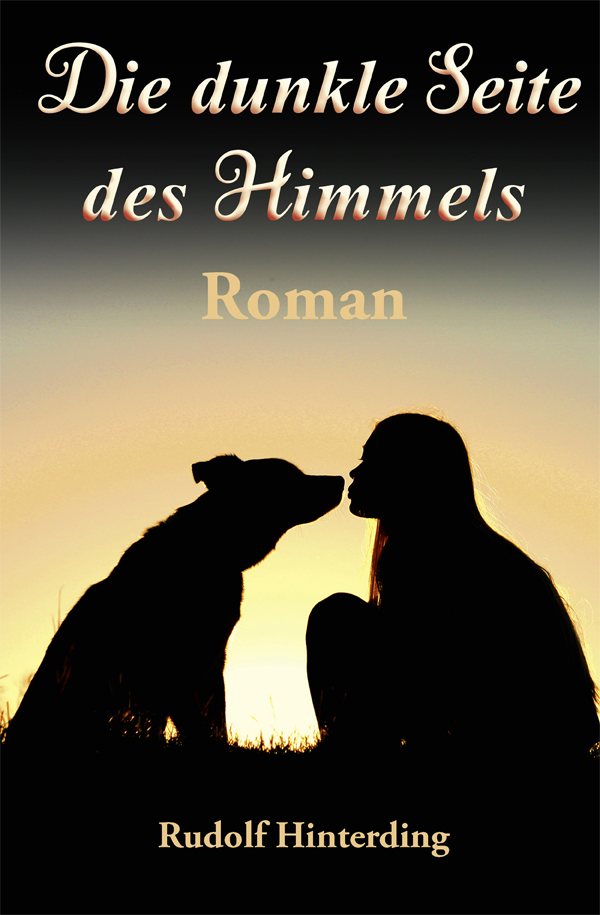Vor ungefähr einem Jahr
Das fehlende Mondlicht verstärkt das Leuchten der Sterne am klaren Himmel. Nur vereinzelt rauscht ein Auto über die Autobahn. Das Licht der Scheinwerfer spiegelt sich in der Schutzwand, die Selbstmördern auf dieser Brücke das Leben schwer machen soll. Eine Teleskopleiter, klein genug für seinen Kombi, hebelt die Funktion der Schutzwand aus. Er lächelt, als er die letzte Sprosse der Leiter erreicht und in der Ferne das spärliche Leuchten einer Kleinstadt registriert. Mit einem tiefen Atemzug saugt er den Duft der Sträucher ein, der sich in der lauen Sommernacht den Weg bis hoch zur Brücke erkämpft hat – ein willkommenes Abschiedsgeschenk der Natur. Ein Blick in die Tiefe lässt nur ein schwarzes Etwas erkennen, wie der Raum zwischen den Sternen.
Die Leiter wackelt, als er die Stimme erneut hört. Nein, er hört sie nicht, er spürt sie. In seinem Kopf vernimmt er sie ganz real. »Ich sehe dich, Papa. Ich sehe dich!« Es ist die Stimme seiner Tochter. Nicht oft in seinem Leben hat er so ein Gefühl verspürt, wie sich sein Herz ausdehnt, es wild zu pochen beginnt und wie Glückshormone seinen Bauchraum fluten. Als er seine Frau kennenlernte, spürte er es und ganz besonders, als er das erste Mal dieses kleine Wunder Nora in seinen Armen hielt und es nie wieder loslassen wollte.
Die Schutzwand schwankt, als er sich auf ihrem Rand aufrichtet und mit beiden Händen die Leiter umfasst. Tief atmet er ein, noch einmal und noch einmal, ehe er sich abstößt, seine Augen schließt und dem schwarzen Teppich entgegen fliegt. »Nora!«, ruft er und fiebert dem Grund entgegen.
»Papa!«
Die Stimme in seinem Kopf wirkt realer, als er sie je zuvor vernommen hat. »Nora«, haucht er. Er öffnet seine Augen. Ist es das gewesen?
Bläulich schimmernd grenzt sich ein endlos gespannter Brückenbogen vom Dunkel der Umgebung ab. Schritt für Schritt, eher schwebend, zieht es ihn auf einem schwarzen Nichts über die Brücke dem einzig erkennbaren Pulk zu, der sich überdeutlich vom restlichen Dunkel abgrenzt, bis er endlich das Brückenende erreicht. Immer klarer erkennt er Menschen und Tiere, die seinen Weg säumen und eine Gasse formen. Sie sehen ihn an und wenden sich sofort wieder der Brücke zu, als hätten sie jemand anderen erwartet. Schließlich sieht er sie.
»Papa, du bist wirklich gekommen.«
»Ja, meine Kleine.«
»Lass uns gehen«, sagt sie, nimmt seine Hand und führt ihn fort.
Er will weinen, schreien und fragen, wo er ist, doch Glücksgefühle übernehmen die Kontrolle. »Ja, Nora. Lass uns gehen.« Er umfasst die Hand seiner Tochter und lässt sich von ihr führen.
* * *
Heute
Ich starre auf das Weiß des Monitors. Fünf Versionen füllen bereits meinen digitalen Papierkorb. Mir fallen einfach keine passenden Worte ein. Den ganzen Tag geht mir diese eine Szene nun im Kopf herum. Ich hätte Krimis schreiben sollen, da sind die Handlungen viel logischer.
Geronimo hat seinen Kopf in meine linke Hand gelegt – er genießt es, wenn ich seinen Hals kraule. Wie so oft sitzt er dicht neben mir auf seiner Matte. Mein Blick lässt nicht vom Monitor ab. »Der Dialog in dieser Szene passt nicht zu den Charakteren.« Er versteht kein Wort von meinem Gebrabbel, aber es erfreut ihn.
Sein flauschiges Fell erzeugt in mir ein Suchtgefühl, das mich immer weiter kraulen lässt. Ich habe bereits eine gewisse Routine darin, nur mit der rechten Hand mittels Einfingerprinzip auf die Tastatur zu hämmern.
Die soeben mühsam erzeugten Zeilen sind wieder gelöscht. Strapaziert vom weißen Monitor schließe ich kurz meine Augen und atme genervt aus. Kaum merklich, dennoch muss Geronimo etwas mitbekommen haben. Liebevoll stupst er mich an und zaubert mir ein Lächeln ins Gesicht. Vergessen ist der Ärger über das ewig weiße Blatt, das einmal eine Szene in meinem Buch werden soll. Ich lehne mich zurück, die Rückenlehne meines Schreibtischstuhls bremst mich angenehm aus. Geronimo macht Männchen und stellt seine Vorderpfötchen auf mein Bein. Freudig entspreche ich seinem Wunsch und nehme ihn auf den Arm.
»Du bist doch mein Schatz. Was würde ich nur ohne dich machen?« Mein Gesicht gräbt sich in sein Fell, dessen Geruch mich sogar durch meine Träume begleitet. Geronimo wirft seinen Kopf zurück und versucht, meinen Hals zu lecken. »Wir sind schon ein tolles Team. Gut, dass ich dich habe.« Ein paar Minuten bleibt er auf meinem Schoß sitzen, bis ihm zu langweilig wird und er wieder herunter springt. Er dreht sich ein paar Mal unter dem Schreibtisch, bis er sich auf meine Füße plumpsen lässt. Ich darf sie jetzt nicht mehr bewegen, weil er sonst erschrocken aufspringen würde. Ohne den Stuhl und die Füße zu bewegen, die Arme unangenehm weit nach vorne gestreckt, greife ich nach der Maus und ticke sie kurz an. Der Bildschirmschoner verschwindet und augenblicklich zieht mich die leere Seite wieder in ihren Bann.
Oben im Schlafzimmer knallt eine Schranktür. In Gedanken sehe ich meinen Mann, wie er sich umzieht. Sensibel wie Meteoriteneinschläge verbleiben mir seine Aktivitäten niemals verborgen. »Dari kann nicht einmal leise denken«, sagten mir seine Eltern bereits vor unserer Hochzeit, vor nunmehr fast zwanzig Jahren. Ich habe mich längst mit seiner trampelhaften Art abgefunden, doch jetzt, wo es mit meinem Buch nicht so richtig vorangeht, stört er mich.
Ein Blick zu Geronimo zeigt mir, dass er den Knall auch gehört hat. Sein Kopf bleibt dennoch fest auf meinen Füßen liegen, während seine Augen zu mir hochblicken. »Kannst du mir nicht einen Tipp geben, wie die beiden Leute miteinander reden könnten, Geronimo?« Seine Ohren richten sich auf. »Vielleicht sollte ich die Umgebung mehr mit einbeziehen, weil dort …«
Die Türklingel schrillt durchs Haus und Geronimo nimmt wie immer den kürzesten Weg, direkt über meine Füße hinweg, um zur Haustür zu preschen.
Daris Stimme schrillt durchs Haus. Er spricht laut, doch bei mir kommt nur ein Nuscheln an. Mir ist aber auch so klar, was er von mir will. Ich folge Geronimo schwerfällig und bin sogar dankbar für die Abwechslung. Sein Bellen schallt durchs ganze Haus.
Mit aufgerichteten Vorderpfötchen lehnt er an der Glasscheibe der Haustür. Sein Atem vernebelt das Türglas, während er den Besucher anbellt. Markus! Dr. Markus Braun, ein Freund meines Mannes – ich habe ihn quasi mitgeheiratet. Sie kennen sich bereits seit Kindertagen, sind gemeinsam zur Schule gegangen und haben sogar beide Psychologie studiert. Ich mag ihn nicht sonderlich, doch Geronimo hat ihn gern und ein Hund hat definitiv die bessere Menschenkenntnis.
»Geronimo, aus! Matte! Das ist Markus, den kennst du doch.« Ich tätschle sein Fell, bis er mit dem Bellen aufhört. Leider bleibt er dicht vor der Haustür sitzen. Die Haustür streift knapp seine Pfötchen, sodass er aufspringt und zur Seite weicht.
»Hallo, Markus.«
»Hallo, Sarina. Nimm mal kurz!« Er reicht mir zwei Flaschen Sekt und bückt sich augenblicklich, um Geronimo zu begrüßen.
»Na komm her, du wilder Häuptling. An dir kommt wirklich niemand vorbei.« Markus streichelt Geronimo heftig, der bereitwillig seine Seite an ihn drückt und seine Streicheleinheiten genießt. Seine Hand sucht etwas in seiner Tasche. »Sieh mal, sind das nicht tolle Leckerchen? Riech mal. Ist das nichts für dich?«
»Komm rein, Markus. Darius kommt gleich.«
Mit einem Happs schnappt Geronimo nach der Leckerei, läuft zu seiner Matte und beißt laut knackend darauf herum.
Markus kommt fast immer unangemeldet vorbei und meistens bleibt er den ganzen Abend. Heute passt es mir nicht, würde ich ihm am liebsten sagen, doch ich gehe mit ihm ins Wohnzimmer. Geronimo leckt sich mit seiner rosa Zunge sein Maul und folgt uns. »Der ist ja sogar kalt.« Ich halte die Sektflaschen nach vorne gerichtet, um den Fokus auf sie zu lenken. »Gibt es etwas zu feiern?«
»Hallo, Markus! Was treibt dich her?« Darius stiefelt die Treppe herunter und zupft sein Hemd zurecht, das er gerade in die Hose gestopft hat.
»Es gibt tatsächlich etwas zu feiern.« Markus zieht ein Papier aus seiner Tasche und hält es hoch. »Ich kann endlich wieder ruhig schlafen«, sagt er mit einem zufriedenen Lächeln im Gesicht. »Das Verfahren gegen mich ist eingestellt worden. Ihr wisst schon … wegen eines meiner Patienten, der als Selbstmörder von der Autobahnbrücke gesprungen ist. Fast genau ein Jahr haben sie mich zittern lassen und immer wieder gedroht, mir meine Approbation zu entziehen.«
»Das ist ja wunderbar.« Ich hole ein paar Sektgläser aus dem Schrank und stelle sie auf den Tisch. »Darauf sollten wir anstoßen.«
Darius zerrt an den Sektkorken herum, bis er endlich mit einem Knall davon fliegt.
Markus wirkt ungewohnt heiter. Er hat zuvor bereits das eine oder andere Glas getrunken, sein Atem verrät es mir. So aus sich herauszugehen, ist eigentlich nicht seine Art. Meistens passt seine Erscheinung auffällig zu seinem Spezialgebiet, der Trauerbewältigung.
»Es konnten keine Anhaltspunkte für ein Fehlverhalten festgestellt werden.« Markus liest diesen Satz von dem Papier in seiner Hand ab. »Freispruch erster Klasse!«, kommentiert er das Schreiben. Er faltet das Stück Papier wieder zusammen und steckt es in seine Tasche.
Darius füllt die Sektgläser. Um ein Haar hätte der Schaum die Gläser übersprudeln lassen. »Na, dann setzt euch mal.«
Mit einem lauten Klirren stoßen die Gläser zusammen, als wir uns zuprosten. Eine Schrecksekunde lang, in Erwartung des Unausweichlichen, warte ich darauf, dass Glas zerbricht, doch es geht noch einmal gut.
Als ich mein Glas abstelle, springt Geronimo zu mir aufs Sofa. Mit seinen Pfötchen wühlt er seine Decke wild durcheinander, dreht sich ein paar Mal und lässt sich endlich darauf fallen. Sein Kopf bleibt unbeweglich liegen, während seine Augen von einem zum anderen wandern, als würde er sich beobachtet fühlen.
»Was hast du nur immer an deiner Decke auszusetzen?«, fragt Dari. »Frauchen legt sie dir doch immer so schön gefaltet aufs Sofa.«
Markus lächelt begeistert. »Du solltest von der Gattung Mensch auf Tierpsychologie umschulen. Bedarf gibt es offensichtlich. Nicht wahr, Geronimo. Dr. Darius Clymer, Tierpsychologe. Das klingt gar nicht mal so schlecht.«
»Da müsstest du aber wohl eher umschulen. Geronimo zählt ja als Verwandter und als Therapeut darf man wohl kaum den eigenen Rudelführer therapieren, da würde es an der nötigen Objektivität fehlen.«
»Geronimo braucht keinen von euch Psychos«, verteidige ich meinen Hund. »Vielleicht solltet ihr beide euch gegenseitig therapieren, das wäre doch interessant.« Meine Hand gräbt sich in Geronimos Fell und streichelt es sanft. Er liegt dicht an mich gekuschelt und tut so, als würde er schlafen. Hin und wieder öffnet er seine Augen, als wüsste er, wann es um ihn geht oder vielleicht auch nur, um den Überblick zu behalten.
»Das haben wir doch längst hinter uns. Im Studium haben wir uns gegenseitig die Seelen blankgezogen. Au Mann, waren das Zeiten.«
»Das will ich alles gar nicht so genau wissen.« Ich setze ein nichtssagendes Grinsen auf.
Darius leert sein Glas in einem Zug. »Das wirst du auch nie erfahren«, warf er ein. »Du weißt doch, das verbietet die Schweigepflicht.«
»Ja, ja, wenn es die Schweigepflicht nicht gäbe. Zum Glück schweigt der Kleine auch.« Ich kraule sanft Geronimos Kopf, der seine Augen genussvoll zusammenkneift.
»Eigentlich ist ein Toter ja kein wirklicher Grund zum Feiern.« Ich habe versucht, meine Stimme nicht zu ernst wirken zu lassen. Im selben Moment wird mir jedoch klar, es wäre besser gewesen, den Mund zu halten. Daris strenger Blick verrät es mir. Die fröhliche Stimmung ist dahin und lässt Geronimo neugierig aufblicken.
»Ist klar, Sarina.« Markus stellt sein Glas auf den Tisch, hebt seinen Arm etwas und zeigt auf mich. »Aber es geht darum, dass ich nichts für den Tod des Mannes kann und man es mir dennoch anhängen wollte. Aber nichts weniger als meine vollkommene Unschuld an dem Tod dieses Mannes wurde nun eindeutig festgestellt.«
»Und genau das feiern wir jetzt«, wirft Dari lauthals ein und schenkt erneut nach. »Man kann einen Selbstmord nicht verhindern. Sollten sich gegebenenfalls Anzeichen für eine solche Tat zeigen, kann man denjenigen einweisen lassen, als Schutz vor sich selbst quasi. Aber wann ist das so? Wer trauert, denkt schon mal über Selbstmord nach, das ist nur natürlich. Man kann so jemanden doch nicht sofort einweisen lassen.«
»Außerdem …« Markus hält kurz inne. »Der Mann tut mir unendlich leid. Unsägliche Zweifel nagen seitdem an mir, ob ich nicht doch irgendwelche Anzeichen eines möglichen Selbstmordes übersehen habe. Doch da war nichts, gar nichts. Vielleicht …? Der Mann war nicht dumm, recht gebildet sogar. Vielleicht wusste er, solche Anzeichen zu verbergen, aus Angst davor, man würde ihn sonst einweisen? Wer weiß das schon?«
Ich habe wohl ins Fettnäpfchen getreten. Die Schlagzeilen der örtlichen Zeitungen sind mir noch gut in Erinnerung. Der Mann hatte mit Vorsatz gehandelt und hatte seine Tat klar über einen längeren Zeitraum hinweg geplant. Die polizeilichen Ermittlungen ergaben ein eindeutiges Bild. Der Mann hatte speziell für seinen Selbstmord eine Teleskopleiter aus dem hiesigen Baumarkt gekauft und war damit zur nächstgelegenen Talbrücke gefahren, immerhin über achtzig Kilometer von hier entfernt.
»Ist ja gut.« Ich versuche, die Situation zu retten. »Ihr habt recht. So war es auch nicht gemeint. Ich lass euch beide jetzt mal allein und gehe mit Geronimo raus, frische Luft schnappen, einen klaren Kopf bekommen. Mit meinem Buch hakt es gerade etwas.«
»Auf deinen Erfolg, Markus.« Ich nehme mein Glas und halte es ihm entgegen. In einem Zug leere ich es und stelle es wieder ab. »Geronimo, kommst du mit? In den Wald?«
Wie angestochen springt er hoch und wedelt mit seinem Schwanz. Zur Bestätigung bellt er zweimal.
Im selben Moment, in dem er mich aufstehen sieht, springt er vom Sofa.
»Komm, kleine Maus. Dann wollen wir mal.«
»Tschau, bis später.« Ich winke den beiden zum Abschied.
»Tschau, Sarina«, antworteten die beiden einstimmig.
* * *
Die Leine in meiner Hand schaukelt im Takt meiner Schritte. Geronimo läuft wie gewöhnlich ein Stück vor mir her, folgt irgendwelchen Duftspuren und hebt hier und da sein Bein. Mächtige Tannen, vereinzelte Buchen und Eichen links und rechts unseres Lieblingsweges versüßen mir den späten Nachmittag. Ich bin mit Geronimo alleine. Nur vereinzelt wehren meine Hände eine Mücke ab. Sonnenstrahlen bahnen sich ihren Weg durch Baumkronen und lassen den Wald zu einer malerischen Spätsommerkulisse werden. Die heiße Sommerluft trägt den Duft von Tannennadeln und hochwachsenden Gräsern mit sich.
Es war dumm von mir, Markus die Laune zu verderben. Ich ärgere mich über mich selbst. So oft hat mir Darius erklärt, wie schmal der Grat eines Therapeuten ist. Ständig steht man mit einem Bein im Knast. Eine nicht ernst genommene Äußerung eines Patienten, die man als Ankündigung eines Selbstmordes auslegen könnte, und schon steht ein Staatsanwalt an der Tür. Die Frage, weshalb du den Patienten nicht eingewiesen hast, warum du als Fachmann ihn nicht vor sich selbst schützen konntest, folgt zwangsläufig.
Es war wohl das Buch, der weiße Monitor, der Schrecken eines jeden Autors, versuche ich, mich vor mir selbst zu rechtfertigen. Doch das ist nicht die Wahrheit – ich werde mich später noch einmal bei Markus entschuldigen. Wenn … Rehe! Ganz vorsichtig tastet sich ein Reh voran, um unseren Waldweg zu kreuzen. Kundschafter nenne ich das erste Reh einer Gruppe. Meist ist es eine Gruppe, selten nur ein einzelnes Reh. Vier Rehe folgen dem Kundschafter, eines nach dem anderen überquert den Weg. Ich halte inne, versuche, sie nicht zu erschrecken. Geronimo bleibt ebenfalls stehen und schaut mich an. Ich sehe es ihm an, wie er mich fragt, ob ich die Rehe auch gesehen habe.
Braver Kromfohrländer, möchte ich ihm zurufen. Zum Glück ist sein Jagdinstinkt schwach ausgeprägt, eben ein Kromfohrländer. Jedem anderen Hund würde ich jetzt durch den Wald hinterherrennen müssen, nur er trottet weiter, als wäre nichts gewesen. Ich liebe meinen Kromfohrländer. Ich bleibe etwas stehen und schaue den Rehen hinterher, wie sie sich ein gutes Stück vom Weg entfernt sammeln. Das Grün des Unterholzes verdeckt sie nahezu vollständig, aber nicht gänzlich. Ob sie mich bemerkt haben?
Geronimo ist weiter gelaufen und steht an einer Wegkreuzung. Ein Pfad kreuzt den Hauptweg. Manchmal gehen wir dort entlang. Geronimo schaut mich an, wartet auf ein Signal von mir, wo es lang gehen soll. Es scheint ihn zu dem Pfad zu ziehen, eher ein unscheinbarer und kaum ausgetretener Insiderweg. »Ja, lauf!«, rufe ich ihm zu und augenblicklich prescht er los, die Schnauze dicht am Boden, auf der Suche nach einer heißen Spur.
Ich beobachte ihn und sein weißes Fell, das nur von ein paar hellbraunen Flecken unterbrochen wird und merke, wie meine Anspannung nachlässt. Nur einmal, ganz kurz versuchen sich Gedanken über mein Buch auszubreiten. Wie beim Zappen am Fernseher knipse ich sie wieder aus. Später, geht es mir durch den Kopf, nicht jetzt. Seit vierzehn Jahren gehe ich täglich mit Geronimo spazieren. Stets ist er bei mir. Ein Fingerzeig, ein Schwenk mit meinen Augen, es braucht nicht viel, damit er mich versteht. Er hat ja auch sein Leben lang nichts anderes getan, als mein Verhalten zu studieren, ebenso, wie ich seines. Doch weshalb er jetzt stehen bleibt, ist mir nicht klar. Seine Vorderbeinchen drückt er ausgestreckt nach vorne, als wollte er einem Gebüsch drohen, das er anbellt.
Eine heiße Spur? Irgendetwas hat er. Jetzt wechselt sein Bellen sich mit einem dunklen Knurren ab. Immer wieder springt er sporadisch einen Schritt auf das Gebüsch zu, um sogleich wieder einen Schritt zurückzuweichen. Sein Schwanz zeigt aufgeregt in die Höhe. Ich eile zu ihm, nicht dass er auf seine alten Tage noch ein Kaninchen jagt. »Geronimo, aus! Komm!« Gleich bin ich bei ihm, als urplötzlich ein Wildschwein aus dem Gebüsch sprintet. Geronimo rennt davon. Starr vor Schreck bleibe ich stehen, eine Schrecksekunde lang, bis ein innerer Impuls mich hinter Geronimo und dem Wildschwein herlaufen lässt.
»Nein! Aaaahhhhhhhhhhh!« Ich schreie mir die Seele aus dem Leib, als das Wildschwein seine Schnauze einem wütenden Stier gleich nach unten hält und Geronimo aufspießen will. Geronimos Hinterteil wirbelt den Sandboden auf, sein scharfer Haken gibt dem Wildschwein keine Chance. Es ist nicht wendig genug.
»Aaaahhhhhhhhhhh! Aaaahhhhhhhhhhh!« Mein Geschrei soll das Wildschwein verjagen, es hängt dicht an Geronimo, ohne von ihm abzulassen. Wieder kommt es Geronimo gefährlich nahe, bis er erneut einen kräftigen Haken schlägt, den Pfad verlässt und querfeldein in den Wald rennt. Äste und Gestrüpp klatschen gegen meine Schienbeine. Er ist schnell. Es ist schwer, ihm zu folgen. Mit meinen Händen wehre ich das Gestrüpp ab. Auf einmal springt Geronimo mit einem gewaltigen Satz über einen Wassergraben. Ich halte die Luft an, als er auf der anderen Seite aufkommt und mit seinen Hinterbeinen an der steilen Böschung abzurutschen droht. Im letzten Moment schafft er es über den Rand der Böschung – ich sehe ihn nicht mehr. Das Wildschwein folgt ihm. Mit einem ebenso beherzten Sprung setzt es über den Graben an, kracht gegen die Grabenwand und rutscht ins Wasser. Es ist zu schwer. Mit einem lauten Quieken stampft es grunzend weiter, den matschigen Graben entlang.
»Geronimo!« Ich presche zum Graben. Scheiße, wie soll ich da drüber kommen? Ein Jaulen, eher ein erbärmliches Wimmern, lässt mich erstarren, zerreißt mir das Herz. »Geronimo!« Ich springe in den Graben, meine Finger krallen sich in die Böschung. Ich versuche, mich hoch zu hangeln. Vergeblich, ich rutsche ab und versinke bis zu den Knien im Schlamm des Grabens.
Ein ersticktes Bellen, dem ein ängstliches Winseln folgt, lässt mein Herz galoppieren. Meine Hände greifen nach Grasbüscheln. Schwarzer Sand zeigt sich, mein Gewicht zieht die Büschel aus der Erde. Ich stemme meine Füße in den Matsch und bekomme endlich einen Ast zu fassen, an dem ich mich hochziehen kann. Der Blick über den Graben schnürt mir die Luft ab. Geronimo versinkt in einem Wassertümpel. Einzig seine Schnauze ragt noch aus dem Wasser hervor. Den Kopf im Nacken schnappt er nach Luft. Meine Arme suchen nach einem Halt, drücken fest auf den Rand der Grabenböschung. Ich ziehe mich hoch, bis meine Beine endlich den Rand der Böschung erreichen. Meine Lunge pfeift wie das Quietschen eines bremsenden Zuges, doch es ist nicht meine Lunge, die mir Angst macht. Es ist die Stille, die mich töten will. Geronimos Kopf verschwindet im Schlamm. Er ist komplett unter Wasser, nur ein paar Blasen sprudeln an die Oberfläche. Augenblickliche Stille erdrückt mein Herz. Ich springe ihm hinterher. Meine Hände greifen in den Matsch, wo eben noch sein Körper war, und heben ihn an. Mit einem kräftigen Schwung werfe ich mich mit ihm in Richtung des Grabens und versuche, ihn über dem Schlamm zu halten.
»Geronimoooooooooooooo!« Ich schreie gegen sein Röcheln an. Schwarze Brühe spritzt aus seinem Maul. Mit seinen Vorderpfötchen zieht er sich aus dem Schlamm, bis er endlich festen Boden erreicht und weiterhin versucht, sich den Schlamm aus dem Leib zu kotzen. Geronimo ist gerettet.
Meine Lunge rast wie ein Presslufthammer. Ich drücke meine Hände auf die Brust, um mein Herz in Zaum zu halten. Geronimo schüttelt sein Fell. Endlich kann ich mich darum kümmern, meine Atmung wieder in den Griff zu bekommen. Doch plötzlich greift etwas nach mir, es zieht mich nach unten. Ich versinke nun ebenfalls im Schlamm. Meine Beine stecken bis weit über die Knie im Morast fest, die Schlammbrühe gereicht mir bis zum Hintern. Mit den Füßen versuche ich, mich abzudrücken, doch sie geben nach, der Schlamm saugt an ihnen, will sie nach unten ziehen.
Meine Hände streifen die Wasseroberfläche ab, doch da ist nichts, kein Ast, kein Gras, nur ein schwimmender Teppich aus Blättern und Tannennadeln auf einer matschigen Wasserbrühe. »Geronimo!« Mir ist, als flüstere ich seinen Namen nur, damit er bloß nicht zu mir kommt. Mit seinen Vorderpfötchen wagt er sich einen Schritt weit in die schwarze Brühe hinein. »Aus!«, rufe ich ihm zu. »Aus!«
Er bellt. Er bellt mich an und ich spüre seine Besorgnis, seine Verzweiflung. Er braucht keine Worte. Nur mit seinem Bellen in verschiedenen Tonlagen vermag er, dasselbe zu sagen wie ich mit tausend Worten.
Ich lasse mich nach vorne fallen. Jetzt ist es mir möglich, mich mit sanften Paddelbewegungen über Wasser zu halten. Alles reine Physik, sage ich mir. Bloß nicht senkrecht stehen, dem Schlamm möglichst viel Widerstand entgegensetzen. Langsam, ganz vorsichtig drücke ich meine Knie gegen den Schlamm. Es ist mir nicht möglich, meine Beine anzuheben, doch wenigstens sinke ich nicht weiter. Ich werde ruhig, nein, ich zwinge mich, ruhig zu werden. Mir scheint, ich habe ein Gleichgewicht erreicht. Ich stecke fest, doch es wird nicht schlimmer. Ich muss ruhig bleiben, erst einmal kräftig durchatmen und Zeit gewinnen. Geronimo will mir helfen und streckt mir sein Pfötchen entgegen. Soll einer sagen, dass Hunde nicht schlau sind.
»Geronimo.« Ich habe nur ihn, meinen Hund. »Geronimo, lauf zu Herrchen! Geronimo, lauf zu Herrchen. Hole Herrchen!« Er legt seinen Kopf zur Seite, das macht er immer, wenn er versucht, mich zu verstehen. »Geronimo, hole Herrchen! Lauf zu Herrchen!« Ich schreie den letzten Satz, bis meine Stimme sich überschlägt. Mit ausgestrecktem Arm weise ich ihn an zu verschwinden. Er jault auf. Er will bei mir bleiben. Ich schreie ihn weiter an: »Geronimo, lauf! Hole Herrchen!« Jetzt wendet er sich endlich ab. Er zögert einen Moment, doch schließlich bellt er und rennt los, ohne sich noch einmal umzudrehen.
Stille breitet sich aus. Sie schreit mich an. Sie hält mich gefangen. Ich fühle mich alleine, schrecklich alleine. Warum habe ich die Stille nicht gehört, als ich mit Geronimo durch den Wald gelaufen bin? Warum kenne ich den Graben und den Matschtümpel nicht? Immerhin gehe ich seit Jahren in diesem Wald spazieren. Ob das Wildschwein zurückkommt? Nur kurz beschäftigt mich diese Frage, als ich mir einer anderen Gefahr bewusst werde. Mücken! Sie wollen mich fressen, aussaugen, … Vielleicht riechen sie meinen Angstschweiß? Ich tauche meinen Kopf kurz in die schwarze Brühe. Anschließend schüttele ich ihn, wirbele meine nassen Haare umher und halte augenblicklich inne. Mein Herz schlägt explosionsartig um sich – meine Füße werden tiefer in den Schlamm gezogen. Bloß nicht bewegen. Was sind schon Mücken im Vergleich zu dem erbarmungslos saugenden Schlamm?
Wie lange ist Geronimo fort? Nie wieder gehe ich ohne Handy spazieren. Meine Beine tauchen mehr und mehr im Schlamm des Tümpels ein, langsam, aber sicher. Ich halte die Luft an, versuche, vorsichtig mit meinen Händen den schwammigen Boden des Tümpels zu ertasten. Vielleicht gelingt es mir, mich irgendwie abzustützen, meine Beine wieder ein wenig aus dem Schlamm zu ziehen? »Scheiße!« Meine Hand versinkt im Schlamm. Als ich sie herausziehe, sacke ich erneut tiefer in den Schlamm. Muss ich jetzt sterben? In einem stinkenden Schlammloch? Geronimo, wo bleibt Geronimo mit Dari?
»Hiiiilfeeee! Hiiiilfeeee!« Ich lausche, doch da ist nur das Summen der Mücken, nicht einmal ein Echo, die Stille hält es zurück. Sie ist mein Feind geworden. Niemand sollte eine solche Stille erleben müssen. »Hiiiilfeeee! Hiiiilfeeee!«
Vielleicht findet Geronimo nicht zurück, oder Dari ist gar nicht zu Hause? Vielleicht ist er mit Markus weggefahren und Geronimo steht vor dem leeren Haus? Ich denke an Dari und Geronimo. Es hätte nicht viel gefehlt und Geronimo wäre im Schlamm gestorben. Er hatte die gleiche Angst wie ich jetzt. Ich konnte meinen Hund retten. Geronimo lebt weiter. Es tut gut, das zu wissen. Solch einen Tod würde ich ihm nicht wünschen, niemandem, mir auch nicht.
Hundegebell, noch weit in der Ferne, doch es ist Hundegebell. »Geronimo!«
»Sarina! Sarina!«
Leise nur, weit entfernt noch, aber ich erkenne Dari, der da meinen Namen ruft. »Hiiiilfeeee! Hiiiilfeeee! Hier! Ich bin hier?«
Endlich ist Geronimo wieder da. Sein Bellen erfreut mein Herz. »Brav, Geronimo. Brav.« Nie war ich stolzer auf meinen Hund.
* * *
Geronimo hasst die Badewanne, doch da musste er heute durch, genauso wie ich.
Markus ist gegangen. Ich sitze mit Dari auf dem Sofa. Geronimo schmiegt sich dicht an mich, als wäre es ein ganz normaler Abend.
Dari hat eine Kerze angezündet und auf den Tisch gestellt. »Zu deinem Geburtstag«, hat er gesagt und sich zu mir gesetzt. »Dein zweiter Geburtstag«, ergänzte er vorwurfsvoll. »Ich war ernsthaft besorgt, als Geronimo alleine und völlig verdreckt nach Hause kam. Du hättest in dem Sumpf jämmerlich krepieren können.«
»Sollte ich Geronimo etwa sterben lassen? Außerdem konnte ich nicht wissen, dass in dem Tümpel gefährlicher Schlamm schlummert.«
»Und wenn du es gewusst hättest? Wärst du rein gesprungen, wenn du es gewusst hättest?«
»Das fragst du ernsthaft? Natürlich hätte ich versucht, meinen Hund zu retten. Du etwa nicht?« Entsetzt registriere ich sein Schweigen. »Schau ihm in die Augen und sage mir und ihm, dass du ihm nicht hinterher gesprungen wärst.« Ich hebe Geronimos Köpfchen etwas an.
»Wahrscheinlich schon. Man überlegt ja in einer solchen Situation nicht groß, man handelt einfach.«
»Das will ich aber auch hoffen.«
»Aber das mit dem Wildschwein, das hättest du nicht tun sollen.«
»Was meinst du?«
»Na dem Schwein hinterherrennen. Ein Mensch hat gegen ein Wildschwein nicht die geringste Chance, nicht ohne Waffe. Du kannst doch nicht einem Wildschwein hinterherrennen. Allenfalls solltest du weglaufen.« Dari wiederholte diese Weisheit heute Abend bereits das dritte oder vierte Mal und schüttelt ebenso wie die Male davor entsetzt seinen Kopf.
»War es eigentlich ein Keiler oder eine Bache?«, fragt er mich.
Darauf erwartet er doch nicht ernsthaft eine Antwort von mir? »Es war ein Wildschwein!« Jetzt schüttele ich verständnislos meinen Kopf. »Meinst du, ich habe das Wildschwein nach markanten Unterscheidungsmerkmalen abgecheckt, ob es ein Männchen oder ein Weibchen ist? Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder?«
»Ein Keiler hat messerscharfe, helle Zähne seitlich an seiner Schnauze, ähnlich wie die Stoßzähne beim Elefanten. Die sind lang wie ein riesiges Küchenmesser. Mit denen kann der Keiler dich aufspießen wie …«
»Hat er aber nicht. Mir sind auch keine Zähne aufgefallen. Außerdem, sollte ich etwa warten, bis er Geronimo damit aufspießt?« Ich rede mich in Rage, meine Stimme wird ungewöhnlich laut.
Geronimo hebt ruckartig sein Köpfchen, als er seinen Namen hört. Ich streichle ihn. »Alles okay, kleine Maus. Schlaf weiter.« Das Streicheln seines Fells beruhigt mich wieder.
»Dann war es sicherlich eine Bache. Wenn die ihre Frischlinge, also ihre Jungen, in der Nähe hat, ist eine Bache nicht weniger gefährlich.«
»Ach komm, jetzt schimpf nicht immer. Du hast mich mit Markus aus dem Schlamm befreit. Dafür bin ich euch auch dankbar. Alleine wäre ich da echt nicht mehr heraus gekommen.«
»Aber mach so etwas nie wieder. Beim nächsten Mal bleibst du ganz ruhig, versuchst, dem Wildschwein die Chance eines Rückzuges zu geben und gehst schön langsam rückwärts, so weit wie möglich weg von dem Viech.«
»Okay, versprochen. Sag mal, bist du ein heimlicher Jäger? Woher weißt du, wie man sich bei diesen Monstern verhalten soll?«
»Ich weiß es einfach.« Dari legt seinen Arm um mich und gibt mir einen Kuss auf die Stirn.
Erst jetzt auf diesem gemütlichen Sofa, Dari und Geronimo neben mir, wird es mir bewusst. Viel hat nicht gefehlt und ich hätte das alles nicht mehr erleben können. Ich lehne meinen Kopf an seine Schulter und genieße es, wie Dari mich zärtlich streichelt und Geronimo sich dicht an meine Beine schmiegt. Es war doch etwas viel heute, das Gähnen lässt sich nicht mehr unterdrücken. »Gehen wir zu Bett?«
Er nickt und steht auf.
Obligatorisch gehe ich mit Geronimo nach draußen, damit er sein Geschäft machen kann. Eine Runde ums Haus, vorbei an dem Lieblingshügel, auf dem er so oft liegt. Wir hatten extra eine ordentliche Portion Sand aufgeschüttet, nur für ihn, weil er so gerne im Sand buddelt. Diese Ecke war sein Lieblingsplatz geworden. Es war ein Geschenk für ihn. Ob er das weiß?
Wie üblich liegt er bereits in seinem Körbchen, als ich aus dem Bad komme und ins Bett gehe. Kaum habe ich mir die Bettdecke übergezogen, steht er am Bettrand, seine Vorderpfötchen auf der Matratze. Sanft, richtig liebevoll, stupst er mich mit seiner Schnauze an – er möchte eingeladen werden. Mein Herz schlägt höher. »Ja komm, kleine Maus. Das hast du dir heute redlich verdient.« Sofort springt er ins Bett, hüpft über mich und lässt sich dicht neben mir fallen wie ein Stein.
»Muss das sein«, murmelt Dari.
»Das muss sein.« Mit meinem Arm umfasse ich Geronimo. »Du warst so tapfer heute, danke«, flüstere ich ihm zu.
Normalerweise kommt er in der Nacht ohnehin ungefragt ins Bett, doch heute zieht es ihn sofort zu mir. Die Ereignisse sind wohl auch an ihm nicht spurlos vorüber gegangen. Ich freue mich darauf, wie er morgen früh meinen Hals ablecken und sich auf meiner ausgestreckten Hand wälzen wird. Mit diesem Bild vor Augen schlafe ich ein.
* * *
Dari war längst aufgestanden. Die Haustür knallte, als er sich auf den Weg zu seiner Praxis gemacht hat. Eigentlich bin ich wach, seit er aufgestanden ist. Leise ist ja nicht sein Ding. Aber vor allem ist Geronimo ebenfalls wach. Mit meinen noch geschlossenen Augen kann ich ihn neben mir spüren, wie er darauf lauert, dass sich meine Augen endlich öffnen. Wann ist Frauchen endlich wach, heißt das Spiel. Falls ich nur ungewöhnlich atme oder irgendetwas anderes Auffälliges mache, wird ihn nichts mehr aufhalten. Ich richte mich auf eine Attacke ein und öffne meine Augen. Sofort kommt er zu mir, legt sich auf mich und leckt mir den Hals, während ich ihm permanent das Fell kraule. »Du tapferes Mäuschen, mein Held«, lobe ich ihn. Mein ausgestreckter Arm lädt ihn unweigerlich ein. Einem Ritual gleich schmeißt er sich darauf und wälzt sich. Sein wohlwollendes Knurren zeigt mir, wie sehr es ihm gefällt. Was kann ein Tag alles Schönes parat halten, wenn er so liebevoll beginnt.
Mein Buch muss warten. Heute werde ich mich nur um Geronimo kümmern. Wir werden an einsamen Feldwegen spazieren gehen, wo es garantiert keine Wildschweine gibt. Vielleicht werden wir heute Mittag Dari in seiner Praxis besuchen. Wir könnten in seiner Mittagspause ein Café aufsuchen. Am Nachmittag werde ich mit Geronimo ausgiebig Verstecken spielen, bei dem er sein Lieblingsspielzeug, ein Quietschehühnchen, suchen muss. Es wird bestimmt ein schöner Tag.
Für den ersten Spaziergang noch vor dem Frühstück fahre ich mit dem Auto raus, dorthin, wo normalerweise höchstens mal ein Bauer seine Felder bearbeitet. Geronimo sitzt aufgeregt auf dem Rücksitz. Immer wieder bellt er, wenn er irgendetwas gesehen hat. Was immer ihn dazu motiviert, es ist zu einer Angewohnheit geworden. Vielleicht ist es die Vorfreude auf den Spaziergang?
Weizenfelder wechseln sich mit endlosen Flächen von gelb blühendem Raps ab. Wir haben den Feldweg für uns alleine. Geronimo läuft wie üblich ein Stück vorweg, stets auf der Suche nach einer heißen Spur. Immer wieder bleibt er kurz stehen und sieht nach mir, viel öfters als sonst. Ob es mit gestern zusammen hängt?
Plötzlich dreht er sich um. Mit angewinkeltem Vorderpfötchen humpelt er zu mir. Frauchen hilf mir, lese ich in seinem Gesicht. Sofort beuge ich mich zu ihm runter und suche sein Pfötchen ab. Ein Steinchen hat sich zwischen seinen Ballen festgesetzt. Ich pule es heraus. »Alles okay.« Er kennt das Prozedere mittlerweile. Als Welpe durfte ich seine Pfötchen kaum berühren. Jetzt kommt er freiwillig zu mir. Es gibt so vieles, das er lernen musste.
Wieder zu Hause springt er auf seinen Sessel und wartet geduldig, bis ich zu ihm komme, um ihn nach Zecken abzusuchen. Routine ist das Zauberwort. Selbst wenn ich es einmal vergesse, sitzt er in seinem Sessel und wartet. Er vergisst es nicht. Drei Zecken finde ich heute in seinem dichten Fell, zum Glück hat er ein so helles Fell. Die Leckerlis als Belohnung fürs Stillhalten sind schnell gegessen.
Auf meinen Joghurt beim Frühstück muss ich heute verzichten. Geronimo sitzt dicht neben mir. Er bettelt nicht, doch seine Augen sprechen Bände. Ich ziehe den Deckel vom Joghurttöpfchen, packe einen Löffel Joghurt darauf und halte ihm den Deckel hin. Sofort fängt er an zu lecken. Als er den Joghurt aufgegessen hat, muss ich ihn festhalten, um sein Maul mit dem Tempo abzuwischen. Das mag er nicht.
Mein zweiter Kaffee wird heute kalt, weil Geronimo seine Vorderpfötchen auf mein Bein stellt. Er will auf meinen Schoß. Routine. Manche Dinge ändern sich zum Glück nie. Ich lehne mich in meinem Sessel zurück und rede mit ihm. Sein Köpfchen liegt auf meinem Arm. Immer wieder richten sich seine Ohren auf, er hört genau zu. Er kann mich zwar nicht verstehen, doch er genießt es, wenn ich mit ihm rede.
Später beim Einräumen der Spülmaschine sitzt er dicht bei mir, eigentlich immer im Weg. Er lässt mich nicht aus den Augen. »Sollen wir Herrchen besuchen?« Er wirft sein Köpfchen zur Seite, versucht zu verstehen, was ich sage. Oder hat er das Wort Herrchen verstanden? »Ja, komm. Wir fahren zu Herrchen.« Heute ist Geronimos Tag, das hat er sich verdient, das habe ich mir fest vorgenommen. Erst besuchen wir Herrchen, danach gehen wir noch einmal ausgiebig spazieren.
Jetzt steht der Besuch bei Dari an. Ich öffne die Heckklappe meines Kombis. Geronimo sieht meinen ausgestreckten Zeigefinger, das Signal für ihn, sitzen zu bleiben. Ich leine ihn an. »Los!« Und schon springt er aus dem Wagen. Vom Parkplatz sind es nur ein paar Minuten bis zu Daris Praxis.
Wir überqueren die Straße, auf der anderen Straßenseite ist Schatten. Geronimo mag die pralle Sonne nicht. Es sind viele Leute unterwegs. Die Gefahr, mit jemanden zu kollidieren, ist groß. Die Leute neigen nicht dazu, nach unten zu schauen, sie erwarten keinen Hund. Eine Gruppe Kinder mit ihren bunten Tornistern auf dem Rücken läuft langsam vor uns her. Vor einem Schaufenster bleiben sie stehen. Ich weiche ihnen aus, führe Geronimo an ihnen vorbei, fast muss ich auf die Straße ausweichen.
Plötzlich kommt ein Motorradfahrer aus einer Hauseinfahrt. Geduldig lässt er uns vorbeilaufen, bevor er losfährt. Ein Knall erschreckt mich, der typische Knall eines Auspuffs. Ich drehe mich gerade um, als ich einen weiteren dumpfen Knall höre, gefolgt vom schrecklichen Quietschen eines Autos. Die Hundeleine spannt. Geronimo schleudert auf den Bürgersteig.
»Geronimoooooooo!« Ich falle mehr zu Boden, als dass ich mich zu ihm herunter knie. Ich stütze mich mit einer Hand am Boden ab, mir wird flau. Mein Kreislauf will zusammenbrechen. »Geronimo, Geronimo, Geronimo.« Immer wieder stammele ich seinen Namen. Meine Hand streichelt ihn, nur ganz leicht. Ich traue mich kaum, ihn zu berühren. Er zittert, krümmt sich am Boden. Seine Augen flehen mich an. Hilf mir, Frauchen, sagen sie. Er winselt. Seine Seite ist stark gerötet, seine Haut hat Abschürfungen.
Ein Mann beugt sich zu mir herunter. »Ich konnte nicht mehr bremsen. Er lief einfach auf die Straße. Ich konnte nichts mehr machen. Es ging alles so schnell.«
Ich höre ihn reden, doch seine Worte erreichen mich nicht. Der Mann ist kaum älter als ich. Mein Blick bleibt nur eine Millisekunde auf seinem dunklen Anzug haften. Sofort bin ich wieder bei Geronimo. »Können Sie mich zum Tierarzt fahren?« Vorsichtig schiebe ich meine Hände unter Geronimo. Er fletscht seine Zähne, es tut ihm weh. Ich ignoriere den Mann. Mit einem Ruck nehme ich Geronimo in den Arm. Erst jetzt bemerke ich die vielen Leute. Sie bilden sofort eine Gasse. Der Mann geht voraus und hält mir die Autotür auf. Behutsam schlägt er sie wieder zu. Geronimo liegt auf meinem Schoß. Das Zittern will nicht aufhören. Er hechelt. Kurz darauf atmet er nicht mehr. Was ist mit seinem Bauch? Bewegt sich etwas? Atmet er noch? Plötzlich winselt er, leise nur und doch lässt es mein Herz stocken. Ich kann ihn kaum mehr erkennen, alles verschwimmt vor meinen Augen, ich kann mir die Tränen nicht abwischen. Ich habe keine Hand frei.
»Wohin?«, fragt der Mann.
Mit meinem Kopf dirigiere ich ihn zum Tierarzt. Nur ab und zu sage ich ihm etwas. »Links, rechts.« Ich kann mich selbst kaum verstehen, meine Stimme gehorcht mir nicht mehr.
Der Mann öffnet mir die Tür zur Tierarztpraxis, während ich ihm mit Geronimo auf dem Arm zu folgen versuche. Die Praxis ist geöffnet. Das Wartezimmer von Dr. Werner Wern ist voll wie immer.
»Autounfall«, sagt der Mann im Anzug zu den Wartenden. Sofort steht eine Frau aus dem Wartezimmer auf und öffnet die Tür zum Behandlungsraum. Beinahe stoße ich mit Geronimo an die Türzarge.
Werner sieht mich an. Ich kenne ihn, seitdem ich Geronimo habe. Er ist ein schriller Kauz mit grauen Haaren und einem langen grauen Bart, der nie Socken trägt. Er legt eine Spritze zur Seite, die er gerade einer Katze geben will. Er nimmt die Katze von dem Behandlungstisch aus Edelstahl und drückt sie einer alten Frau in den Arm.
»Das hat Vorrang«, sagt er zu ihr und zeigt auf den blanken Behandlungstisch. Behutsam lege ich Geronimo dort ab. Die Frau mit der Katze verlässt den Raum.
»Autounfall«, höre ich jemanden sagen, der Anzugmann ist noch da. »Er ist mir direkt vor den Wagen gelaufen. Ich …«
Werner nickt nur mit dem Kopf und zeigt kurz mit seiner Hand zur Tür. Ich höre sie ins Schloss fallen.
Als eine Hand meine Schulter berührt, drehe ich mich erschrocken um. Es ist die Helferin, die mir ihr Mitleid ausdrücken will. Ich kenne nicht einmal ihren Namen.
Werner bückt sich über Geronimo. Er tastet ihn ab, ganz behutsam und doch fletscht Geronimo seine Zähne. Ich streichle sein Köpfchen und versuche, den Augenkontakt mit ihm zu halten. Er soll mich sehen, ein bekanntes Gesicht sehen. Vielleicht nimmt ihm das etwas von seiner Angst? Nur kurz hebt Werner seinen Kopf und sieht zu mir. Sofort senkt er ihn wieder und kümmert sich weiter um Geronimo. Plötzlich erhebt er sich, dreht sich um und nimmt sein Stethoskop aus dem Regal an der Wand. Es ist so still, als er Geronimo abhorcht. Es ist diese Stille, die ich gestern im Wald gehört habe, die mich fast getötet hat. Sie bedeutet nichts Gutes. Ich höre sogar meine Tränen, die auf den Behandlungstisch tropfen – ich kann sie nicht zurückhalten.
Ich will nach Hilfe schreien, verschwommen nehme ich die Helferin wahr. Ihr hilfloser Blick bleibt mir nicht verborgen. »Was hat er?«, frage ich, doch es geht in meinem Schluchzen unter.
…
Dies ist nur eine Leseprobe